Von Passivität und Privileg
Vom Klima und Kindern
»Diejenigen, die das Privileg haben zu wissen, haben die Pflicht zu handeln.«
Das soll Albert Einstein einst gesagt haben. Ich habe diesen Spruch oft zitiert. Auf Podien. In Social Media Beiträgen. Bei Vorträgen. Wieder und wieder. Er leitete mein Streben, die akademische Community für den Klimakollaps zu sensibilisieren; und für die eigene Verantwortung dabei.
Es gibt zwei Fragen, die mir dazu oft gestellt werden. Die eine lautet: „Was macht Ihnen eigentlich Hoffnung?“ Ich habe mich dazu schon öfter geäußert; hier etwa. Die zweite Frage lautet: „Wie vereinst du dein Klima-Engagement eigentlich mit deiner Rolle als Vater kleiner Kinder?“ Darum soll es nun gehen.
Das Thema Kinder ist eines der emotionalsten im gesamten Klimadiskus. Einige, die die ganze Brutalität der Klimanotlage voll an sich heranließen, haben sich bewusst gegen eigene Kinder entschieden. Andere, und dazu zähle ich mich auch, schöpfen gerade daraus bisweilen Antrieb.
Es hat im Klimadiskurs viel Auseinandersetzung darum gegeben, was Menschen besser erreicht. Die Warnung vor apokalyptischen Szenarien, die es zu verhindern gilt? Oder die positive Vision einer klimagerechten Welt, die zu schaffen erstrebenswert scheint? Ich kann das nicht beurteilen, weil es nicht mein Fachgebiet ist. In meiner Erfahrung ist beides wichtig. Manche Menschen werden durch das eine erreicht, andere durch das andere. Ich selbst habe oft eher düster und warnend kommuniziert; weil meine Erfahrung mit der Positivkommunikation war, dass Menschen das dann immer auch irgendwie optional wahrnehmen. „Klingt inspirierend, was du da erzählst; aber so wie es bisher war, war es ja auch ganz nett.“ Der Maßstab für die an sich nötige, unfassbar massive Transformation auf technologischer, ökonomischer, gesellschaftlicher und individueller Ebene ist bei vielen eben nicht die abzuwehrende Klimahölle; sondern die wohlige fossile Vergangenheit.
Das alles ist bis hierhin schon kompliziert genug. Umso schwieriger wird es nun, wenn Kinder und eine Familie im Spiel sind. Für mich selbst fiel die Zeit der Klima-Erkenntnis und Schockverarbeitung mitten in diese Phase. Meine Große war damals zwei Jahre alt, und der Kleine gerade geboren. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das überhaupt überstanden habe. Die Phase des Elternwerdens würfelt eh alles durcheinander. Und wenn du dann gerade noch mittendrin steckst zu erkennen (und emotional zuzulassen), dass nichts aber auch gar nichts in der Zukunft so sein wird, wie du es dir bis vor Kurzem noch ausmaltest, dann ist das … nicht in Worte zu fassen.
Ich habe schon oft geschildert, was danach passierte. Ich begann aktiv zu werden. Auf vielen Ebenen; rückblickend wohl auf zu vielen. Bei den Scientists for Future. Als Kandidat zur Bundestagswahl 2021. Durch Umstellung meiner Forschung und Lehre. Und im Diskurs; auf Podien, mit Vorträgen, und in Sozialen Medien. Mit allen Abgründen und aller Einsamkeit, die das mit sich bringt. Wieder und wieder löschte ich „erfolgreiche“ Tweets, sobald diese „die andere Seite“ erreichten. Allein zuhause sprechen eben selbst 10.000 Likes nicht in dem Maße zu, wie 50 Hasskommentare verletzen.
Bei all dem vernachlässigte ich einiges. Vor allem meine Familie. Viel zu oft ließ ich dort meinen Frust ab; nie absichtlich, nie bewusst, und nie grenzüberschreitend … aber eben immer wieder. Und viel zu oft war ich nicht da. Sinnbild ist für mich ein Schnappschuss, den mir meine Frau im Mai 2022 aufs Handy schickte. Ich diskutierte gerade im Mainzer Hörsaal mit Lea Dohm, Sara Schurmann, Özden Terli und Harald Lesch zur Frage „Muss Wissenschaft lauter werden?“ Und zuhause durfte die Große den Stream mit anschauen, verstand zwar kein Wort, aber fand es wahrscheinlich einfach cool, dass sie lange aufbleiben durfte und Papa im Fernseher war. Das Bild machte mir ein unglaublich schlechtes Gewissen. Weil es zeigte, wie ich zwar (vermutlich vergeblich) versuche irgendwie die Welt zu retten, aber dabei für meine kleine, gleichsam wertvolle Welt daheim nicht da bin.

Von Selbstwirksamkeit und Scheitern
Ich hatte jüngst mit meiner Frau ein Gespräch über diese Zeit. Ich wollte mich entschuldigen für all das, was sie und die Kinder in den vergangenen Jahren ertragen und auffangen mussten. Ihre Antwort verblüffte mich: „Es ist gut, dass du so viele Aktionsfelder gefunden hast. Als du die noch nicht hattest, da warst du wirklich unerträglich.“ Es ist vermutlich ein Ausdruck dessen, was ebenfalls im Klimadiskurs immer wieder proklamiert wird: Selbstwirksamkeit. Ja, es fühlt sich gut an, ins Handeln zu kommen. Und doch kann es auch frustrieren; wenn du merkst, dass du damit in deinem Umfeld vor allem erstmal als der Freak, der Öko, der Moralapostel wahrgenommen wirst. Ein wirklich guter und geschätzter Kollege sagte mir einst im Vertrauen: „Ganz ehrlich, die meisten hier im Kollegium finden das, was du treibst, ziemlich lächerlich. Fokussiere dich doch mal wieder mehr auf deine Wissenschaft.“
Früher hätte mich das hart getroffen. Denn lang war es mir unglaublich wichtig, beliebt zu sein. Nun, zumindest das hat sich in den Jahren des ganzen Aufreibens geändert. Vielleicht ist dies das einzig Gute an all dem Gegenwind; er raut ab. Und vielleicht auch deswegen fokussierte ich meine Aktivität zunehmend auf meine eigene Fachcommunity. Die Transformation der akademischen Gesellschaft und des wissenschaftlichen Betriebs hin zu mehr Bewusstsein für die dramatische Klimanotlage war seither eines meiner Haupttätigkeitsfelder. Und ein Quell stets neuen Frusts.
Seit 2023 bin ich Sprecher eines Sonderforschungsbereichs. In einem früheren Leben wäre das mein Karriere-Olymp gewesen. Ich hätte mich fortan auf Konferenzen als Plenary Speaker feiern lassen und mich im Feld groß und wichtig gefühlt. Inzwischen ist das ganz anders. Ich versuche vielmehr, in dieser Rolle zumindest noch ein paar Impulse und Akzente zu setzen. Ein Thema etwa, das mir ganz wichtig war, ist Flugverzicht im Forschungsbetrieb. Ich habe probiert, das in „meinem“ Sonderforschungsbereich durchzusetzen. Nun ja … ich bin damit krachend gescheitert.
Mit dem wachsenden Frust wurde auch meine Kommunikation konfrontativer. Diese lähmende Passivität in weiten Teilen des akademischen Betriebs, dieser immer wieder vorgehaltene Neutralitätsanspruch, dieses Verstecken hinter Exzellenz und Superlativrhetorik, es frustrierte mich so unfassbar. Und so griff ich genau dies auf und fing an, meiner Community auf die Nerven zu gehen. „Passivität ist nicht neutral“ war fortan einer meiner Leitsprüche. Genauso wie „wir sind alle Aktivisten“. Zu beidem stehe ich nach wie vor. Jedes Handeln von uns bestimmt die Zukunft. Auch und besonders jedes Nichthandeln. Es gibt immer Gründe für letzteres. Doch ihre Summe hat uns genau dahin geführt, wo wir nun stehen. Mitte der Zwanzigerjahre ist der Klimaschutz gesellschaftlich gescheitert. Das Momentum von 2019 ist verloren. Es ist nicht gelungen, den globalen CO₂-Peak bis zur Hälfte der Zwanziger zu erreichen; gefolgt von einem unfassbar steilen Reduktionspfad, steiler noch als beim kurzen globalen Innehalten im März 2020.
Stattdessen steigen Temperaturen und Emissionen weiter, und Eigendynamiken im Erdsystem kommen in Fahrt — während sich Gesellschaften global von all dem mehr und mehr abwenden; messbar von einer Wahl zur anderen. Ich erinnere mich an jeden einzelnen dieser Abende. Sei es der gescheiterte Berliner Klimaentscheid 2023, die Europawahl 2024, oder die Bundestagswahl 2025. Es ist brutal, wenn dir bewusst ist, wie es um das Klima steht und was das bedeutet, und du dann wieder und wieder pünktlich um 18 Uhr erfährst, dass große Teile der Gesellschaft auf all das einfach keinen Bock haben. Es sticht ins Herz, wenn du danach deine zwei kleinen Kinder ins Bett bringst, die dort selig und unschuldig mit ihren Stofftieren einschlafen und noch nichts von ihrer Zukunft ahnen. Schon am 26.9.2021 formulierte ich genau das kurz nach der 18-Uhr-Prognose zur damaligen Bundestagswahl in einem Tweet. Es war mein „erfolgreichster“ dort, mit vielen tausend Likes, Reposts und Zitationen, weil er offenbar vielen aus dem Herzen sprach. Und doch gab es auch dafür in den Tagen danach gleichsam einiges an Häme, Spott und Herzlosigkeit.
Es gäbe jetzt viele Gründe, hierüber in Resignation zu verfallen. Zum Glück habe ich diese Phase hinter mir. Meine Klima-Akzeptanz scheint inzwischen zumindest dafür weit genug — jedenfalls momentan. Gerade weil die Klimakrise nun zur Klimanotlage geworden ist, und gerade weil wir von Katastrophe zu Katastrophe in den Kollaps laufen, gerade deswegen gilt umso mehr, nicht aufzugeben. Nicht aus Hoffnung. Sondern aus Menschlichkeit. In einem kämpferischen Redebeitrag äußerte ich dies beim jüngsten Klimastreik Anfang 2025. Wieder gepaart mit dem Appell: „Passivität ist nicht neutral. Der Moment sich aufzuraffen, er ist genau jetzt!“
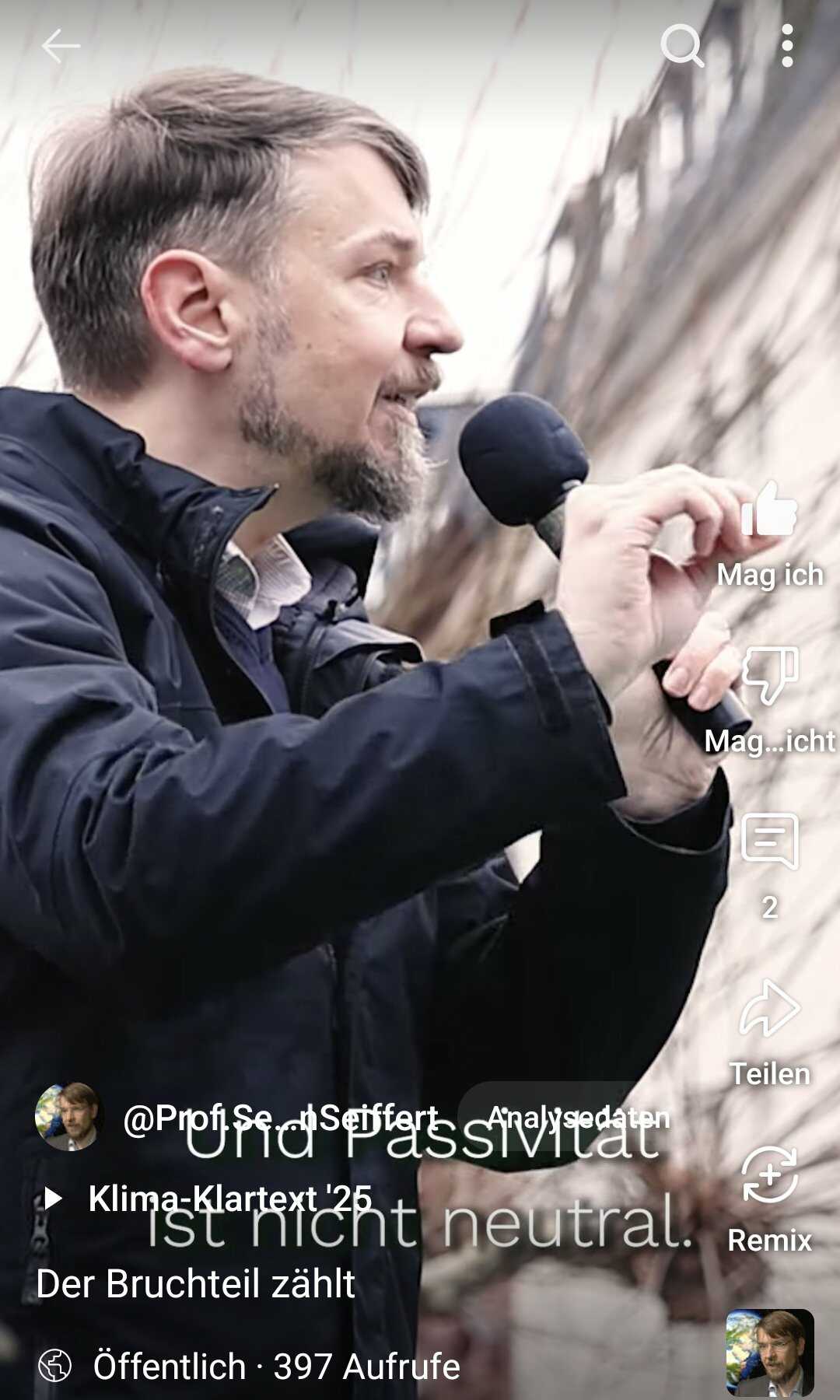
Vom Kämpfen und Können
Nur zwei Wochen später servierte mir das Leben einen abrupten Perspektivwechsel. Unfreiwillig. Eines Abends äußerte die Große Schmerzen in den Gelenken. Tags darauf wirkte sie abgeschlagen und appetitlos. Und am folgenden Morgen war am ganzen Körper unübersehbar, dass etwas nicht stimmt. Noch am selben Tag fanden wir uns in der Klinik wieder. Es sollten zwei Wochen dort werden — gefolgt von einigen weiteren daheim, in denen wir aus dem Alltag gekegelt waren. Noch immer sind wir auf einem langen Weg mit Höhen und Tiefen, mit Ernüchterungen und Erleichterungen.
Ich will mich nicht beschweren; es gibt viele, so viele Eltern, die weit mehr durchmachen. Einige davon habe ich in der Klinik kennengelernt. Ich nehme vielmehr mit Demut auf, was mir diese Zeit zeigte: Viele, so viele haben Kämpfe auszutragen, von denen viele, so viele nichts mitbekommen. Und Sprüche wie „Passivität ist nicht neutral“ sagen sich leicht, wenn du sonst keine Sorgen hast. Ja, diejenigen, die das Privileg haben zu wissen, haben die Pflicht zu handeln — das stimmt schon. Es braucht aber noch etwas: Möglichkeit. Und eben die haben viele nicht.
Was heißt das nun? Stelle ich nun alles infrage, was ich zuvor gesagt habe? Nein. Ganz im Gegenteil. Denn umso mehr kommt es auf die wenigen an, denen oft gar nicht klar ist, wie groß ihr Privileg eigentlich ist. Das Privileg halbwegs abgesichert, halbwegs gesund und halbwegs sorgenfrei zu sein.
Dieser Tage kollabieren Selbstverständlichkeiten. Das Autoritäre lechzt nach Macht. Und Stürme ganz rauer Veränderung ziehen auf; oder besser gesagt: sie wüten schon. Und allzu viele sind so überfordert mit allem, dass nicht mal Raum für Ohnmacht bleibt. Wie nie zuvor bräuchte es nun den Bruchteil derer, die wissen, wollen und können.
Wie so oft wäre an dieser Stelle nun ein Happy End schön. Ein Twist. Ein Hoffnungsschimmer. Doch es gibt ihn nicht. Jedenfalls nicht direkt.
Lange versuchte ich, Impulse für all das zu setzen. Doch es drang nicht durch. Jedenfalls nicht ausreichend. Ständig schwankte ich zwischen Dynamik und Depression. Und jetzt ist sowieso erstmal vieles anders. Meine Aufgabe ist nun, endlich voll und ganz für die da zu sein, die mir alles bedeuten.
Eines aber wird mir gerade wieder sichtbar. Es gibt so unfassbar gute Menschen. Auf Kinderstationen. In Notaufnahmen. In der Pflege. Jeder Mensch, der für andere Menschen da ist. Sie verdienen, dass andere für sie kämpfen. Besonders jene mit besonderen Privilegien. Falls das hier also zufällig jemand aus meinem Berufsstand liest: vielleicht mögt ihr ja mal überlegen, ob ihr in Anbetracht all dessen nicht vielleicht auch mal … ach, sei es drum.
Zum Schluss hier vorerst nur noch eine Botschaft und Bitte: Umarmt eure Liebsten. Herzt eure Kinder. Nehmt jeden Trotzanfall dankbar auf. Die Welt draußen kollabiert. Erhaltet euch zumindest die kleine Welt um euch. Sie ist alles.
Und wer das Privileg hat zu handeln, werde sich bitte dessen bewusst. Allzu viele haben es nicht.
